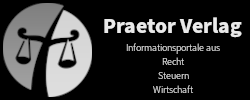Eingetragen oder nicht eingetragen – das ist (k)eine Frage
Die meisten Schützenvereine sind im Vereinsregister eingetragen und besitzen damit als „eingetragene Vereine (e.V.)“ eine eigene Rechtsfähigkeit. Gleichwohl kommt von einer Reihe von Vereinen, die bisher nicht im Vereinsregister eingetragen sind, immer wieder die Frage, ob sie auch den Status eines „eingetragenen Vereins“ anstreben sollen oder weiter „nicht eingetragen“ bleiben sollen. Was ist also der Unterschied zwischen einem eingetragenen und einem nicht eingetragenen Verein?
Zunächst einmal ist festzuhalten, dass zwischen dem eingetragenen und dem nicht eingetragenen Verein heute nicht mehr viele Unterschiede bestehen, da insbesondere über die Satzung der nicht eingetragene Verein so gestaltet werden kann, dass auch für ihn die gesetzlichen Vorschriften über das Recht der eingetragenen Vereine gelten. Gleichwohl bleiben noch einige entscheidende Unterschiede: Der erste Unterschied besteht zunächst darin, dass nur der eingetragene Verein eine eigene Rechtsfähigkeit besitzt. Rechtsfähigkeit bedeutet, selbst Träger von Rechten und Pflichten sein zu können.
Fehlt es an dieser eigenen Rechtsfähigkeit, so kann der Verein nicht selbst als eigene Rechtspersönlichkeit im Rechtsleben auftreten. Dies bedeutet unter anderem, dass der nicht eingetragene Verein nicht selbst unter seinem Namen klagen kann. Will der nicht eingetragene Verein also z.B. ein Recht durchsetzen, etwa einen Schadensersatzanspruch oder einen Zahlungsanspruch, so kann nicht der Verein selbst diesen Anspruch einklagen, sondern die Klage muss, so verlangt es der Bundesgerichtshof, unter einzelner namentlicher Nennung sämtlicher Mitglieder in deren Namen erhoben werden. Aber auch beim Erwerb von Rechten gibt es für nicht eingetragene Vereine Probleme, die ein eingetragener Verein nicht hat. Soll etwa ein Grundstück für ein Schützenhaus erworben werden, kann nur ein rechtsfähiger Verein, also ein e.V., in das Grundbuch eingetragen werden, nicht aber ein nicht rechtsfähiger. Aber auch im alltäglichen Leben können sich Schwierigkeiten ergeben. So sind etwa eine Reihe Banken nicht bereit, für einen nicht eingetragenen Verein ein Konto zu eröffnen, sodass sich der nicht eingetragene Verein damit behelfen muss, dass das Konto auf ein Vorstandsmitglied, etwa den Schatzmeister, eröffnet wird und dieser das Konto treuhänderisch für den Verein verwaltet, was bei einem Wechsel im Vorstand zu einigem Aufwand führt, den ein eingetragener Verein nicht fürchten muss.
Der zweite Unterschied besteht bei der Frage der Haftung für Verbindlichkeiten des Vereins. Bei einem eingetragenen Verein ist die Rechtslage einfach: Der Verein haftet nur mit seinem Vereinsvermögen für seine Verbindlichkeiten. Daneben gibt es grundsätzlich keine persönliche Haftung des Vorstandes oder der Vereinsmitglieder, eine persönliche Haftung des einzelnen (Vorstands-)Mitglieds muss vielmehr jeweils im Einzelnen begründet werden, was nur in ganz bestimmten, gesetzlich eng umrissenen Fällen möglich ist und stets ein entsprechendes Fehlverhalten des Vorstandsmitglieds voraussetzt. Über diese Haftungsfälle wurde auf SCHÜTZENRECHT ja bereits mehrfach berichtet. Anders sieht die Rechtslage jedoch bei einem nicht eingetragenen und damit nicht rechtsfähigen Verein aus. Zwar ist hier die Haftung für die einfachen Vereinsmitglieder regelmäßig (aber nicht zwingend) auf das Vereinsvermögen beschränkt.
Aber jedes Vorstandsmitglied oder sonst für den nicht eingetragenen Verein handelnde Person haftet aus jedem Rechtsgeschäft, das es einem Dritten gegenüber für den Verein vornimmt, auch persönlich. Der jeweils Handelnde haftet dabei unabhängig davon, ob er Vorstandsmitglied oder auch überhaupt nur Vereinsmitglied ist, und auch unabhängig davon, ob er überhaupt zur Vertretung des Vereins berechtigt gewesen ist. Plastisch – aber keineswegs übertrieben – ausgedrückt: Wird z.B. ein Schützenfest etwa wegen schlechten Wetters zu einem finanziellen Fiasko, haftet derjenige, der etwa eine Musik oder den Getränkelieferanten für dieses Fest im Namen der Bruderschaft bestellt hat, für die Kosten dieser Musik oder auch für die Kosten der Getränkelieferung persönlich mit seinem privaten Vermögen. Oder ein anderes Beispiel, etwa aus der Jugendarbeit, die wohl jede unserer Bruderschaften betreibt: Verletzt sich etwa bei einer Gruppenstunde ein Kind, so haftet bei einem eingetragenen Verein regelmäßig zunächst der Verein, bei einem nicht eingetragenen Verein die jeweilige Aufsichtsperson persönlich. Insgesamt also starke Argumente für die Eintragung in das Vereinsregister.
Die Nachteile einer Eintragung wiegen dagegen leicht: So muss die Satzung den gesetzlichen Erfordernissen entsprechen, die auch bereits Thema hier auf SCHÜTZENRECHT waren. Und schließlich: Die Eintragung, etwa jeder Änderung im Vorstand, kostet Notargebühren, da jede Anmeldung zum Vereinsregister einer notariellen Beglaubigung bedarf. Aber diese Gebühren sind minimal im Vergleich zu den Vorteilen, welche die Eintragung und damit die Rechtsfähigkeit bieten.
Also: Wenn ein Schützenverein noch nicht im Vereinsregister eingetragen ist, sollte er dies nachholen – alleine schon, um die für den Verein Handelnden nicht unnötigen Haftungsrisiken auszusetzen.