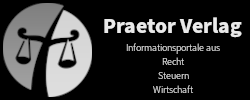Haftung auf dem Schießstand
Nach der Unfallstatistik zählt der Schießsport zu den sichersten Sportarten. Genau genommen ist es die zweitsicherste – nur beim Schachspiel passiert noch weniger. Doch diese Zahl in der Statistik ist nur die eine Seite. Die andere Seite:Wenn einmal ein Unfall passiert, hat er oftmals massive Folgen. Und es stellt sich dann regelmäßig die Frage der Haftung für die Unfallfolgen. Hierbei kommen grundsätzlich zwei Haftungsschuldner in Betracht: der Unglücksschütze, der den Unfall verursacht hat, und der den Schießstand betreibende Schützenverein.
Der Schütze, der den Unfall verursacht hat, haftet grundsätzlich nach den allgemeinen Regeln. Das bedeutet, er haftet immer dann, wenn er fahrlässig nicht die Sorgfalt beachtet hat, die in der jeweiligen Situation zu beachten war. Mit anderen Worten: Der Unglücksschütze haftet immer dann, wenn er nicht die Sicherheitsbestimmungen beim Schießen beachtet hat.
Haftung des Vereins
Aber was ist mit der Haftung des Vereins oder gar seines Vorstandes? Nun, die mit der Bruderschaft (als – im Folgenden unterstellt – eingetragenem Verein) in Zusammenhang stehenden Ansprüche des Unfallopfers richten sich zunächst grundsätzlich und ausschließlich gegen den Verein und nicht gegen den Vorstand oder das handelnde Mitglied.
Eine persönliche Haftung der einzelnen Vorstandsmitglieder oder etwa der Schießstandaufsicht kommt jedoch immer dann in Betracht, wenn das Vorstandsmitglied oder die Schießstandaufsicht gegen gesetzliche Vorschriften verstößt, die auch dem Schutz dritter Personen dienen.
Derartige Schutzvorschriften sind etwa die strafrechtlichen Vorschriften zur Körperverletzung und Sachbeschädigung, aber auch die allgemeinen Verkehrssicherungspflichten sowie die besonderen Vorschriften des Waffenrechts.
Aufsichtspersonen auf dem Schießstand
So gibt etwa das Waffenrecht in § 10 der Allgemeinen Waffengesetzverordnung vor, dass grundsätzlich kein Schießbetrieb zulässig ist, solange nicht genügend Aufsichtspersonen auf dem Stand anwesend sind. Die Bestellung dieser Aufsichtspersonen obliegt dem Schießstandbetreiber, also im Regelfall dem Schützenverein. Mit der Anerkennung des jeweiligen Dachverbandes als Schießsportverband sind auch die Mitgliedsvereine selbst für die Bestellung der Schießstandaufsichten verantwortlich. Das bisher geltende Verfahren, dass die Aufsicht der Waffenbehörde gemeldet wird und zwei Wochen später die Aufsicht führen darf, wenn keine die Waffenbehörde keine Einwände erhoben hat, ist mit der Anerkennung des Dachverbandes als Schießsportverband für seine Mitgliedsvereine entfallen, seitdem darf derjenige die Schießstandaufsicht führen, der von dem Verein in ein entsprechendes, vom Verein zu führendes Verzeichnis aufgenommen wurde. Dies hat das Verfahren auf der einen Seite gegenüber dem bisherigen Rechtszustand vereinfacht, da die Waffenbehörde nicht mehr mit einbezogen werden muss. Auf der anderen Seite übernimmt der Schützenverein aber auch eine erhöhte Verantwortung, etwa wenn er eine Schießstandaufsicht einsetzt, die nicht die erforderliche Qualifikation aufweist.
Auf der sicheren Seite ist hier stets der Schützenverein, der nur solche Mitglieder zur Schießstandaufsicht zulässt, die im Besitz derjenigen Qualifikationen sind, die die vom Bundesverwaltungsamt genehmigte Sportordnung vorsieht. Lässt aber der Schützenverein etwa die Schießstandaufsicht durch ein Mitglied führen, dass nicht hinreichend qualifiziert ist, liegt insoweit ein Organisationsverschulden des Schützenvereins vor, das immer dann zur Haftung führen kann, wenn nicht auszuschließen ist, dass der Unfall genau so auch bei einer qualifizierten Aufsicht geschehen wäre.
Und dies gilt nicht nur bei der „normalen“ Schießstandaufsicht, sondern insbesondere auch beim Schießen mit Kindern und Jugendlichen. Soweit das Waffengesetz hier eine besondere Obhut durch zur Kinder- und Jugendarbeit für das Schießen besonders geeignete Aufsichtspersonen vorschreibt, muss auch eine solche besonders qualifizierte Aufsicht auf dem Stand vorhanden sein. Dies betrifft das Schießen mit dem Luftgewehr oder der Luftpistole für Jugendliche bis 14 Jahre und das Schießen mit anderen Waffen bis 16 Jahre. In diesen Fällen muss also stets eine Schießstandaufsicht auf dem Stand sein, die die Qualifikation zum Jugendschießleiter aufweist, will der Verein nicht ein Haftungsrisiko eingehen.
Das Gleiche gilt auch, wenn die Schießstandaufsicht es zulässt, dass jemand an dem Schießstand schießt, der hierzu – etwa wegen Alkoholisierung oder Unterschreitens der gesetzlichen Altersgrenze – nicht in der Lage ist. Auch hier steht stets eine Haftung des Vereins im Raum, wenn die Schießstandaufsicht nicht einschreitet.
Haftpflichtversicherung
Bei dem Thema Haftung und Schießstand denken die meisten sicherlich zuerst an die Haftpflichtversicherung, und das nicht ohne Grund: So darf nach den Bestimmungen des Waffengesetzes die Erlaubnis zum Betrieb eines Schießstandes nur erteilt werden, wenn der Schießstandbetreiber, regelmäßig also die Schützenbruderschaft, über eine Haftpflichtversicherung und eine Unfallversicherung verfügt. Die Haftpflichtversicherung muss dabei eine Versicherungssumme von mindestens eine Mio. Euro pauschal für Personen- und Sachschäden aufweisen, die Unfallversicherung eine Versicherungssumme in Höhe von mindestens 10.000 Euro für den Todesfall und mindestens 100.000 Euro für den Invaliditätsfall.
Aber auch hierbei gilt eines zu beachten: Die Haftpflichtversicherung ist von der Leistung frei, wenn der Schaden grob fahrlässig verursacht wurde, also etwa immer dann, wenn die erforderliche Sorgfalt in einem besonders groben Maße außer Acht gelassen wurde. Dies kann etwa dann der Fall sein, wenn eine erkennbar unqualifizierte Aufsicht in Kenntnis der fehlenden Qualifikation eingesetzt wurde. In derartigen Fällen ist also auch die Haftpflichtversicherung