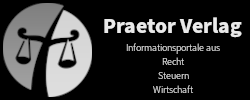Wer ist im Namen des Vereins unterwegs?
Ein Verein lebt nicht nur für sich allein, er tritt ständig und in vielfältiger Weise in Kontakt mit seiner Umwelt, und dies auch in rechtlicher Hinsicht. Der Schützenverein lädt Gäste zu ihren Veranstaltungen ein, sie engagiert Musikkapellen für ihre Bälle und Umzüge, sie unterhält ein Bankkonto und schließt Versicherungsverträge ab …
Bei alledem stellt sich immer wieder die Frage, wer denn hierbei für den Verein handelt, oder besser gesagt: wer denn für den Verein handeln und damit für den Verein Rechte und Pflichten begründen darf.
Der Vorstand
Das Bürgerliche Gesetzbuch sagt hierzu, dass der Verein einen Vorstand haben muss und dass dieser Vorstand den Verein gerichtlich und außergerichtlich vertritt. Der Vorstand ist also der gesetzliche Vertreter des Vereins in allen rechtlichen Belangen. Wobei der gesetzliche Begriff des Vorstandes durchaus von dem abweichen kann, was in den einzelnen Schützenvereinen und Bruderschaften als Vorstand verstanden wird; Vorstand im Sinne des Gesetzes ist immer nur der „geschäftsführende Vorstand“, er umfasst also nicht unbedingt alle Funktionsträger des Vereins. Wer genau zu diesem gesetzlichen Vorstand gehört, ist in der Vereinssatzung geregelt.
Nach den meisten Satzungen dürfte dies der Vorsitzende, sein Stellvertreter, der Schriftführer (bzw. Geschäftsführer) und der Kassierer (bzw. Schatzmeister) sein, aber dies ist nicht zwingend, denn grundsätzlich ist es dem Verein freigestellt, in seiner Satzung die Anzahl der Vorstandsmitglieder selbst zu bestimmen. Der Verein kann also auch noch weitere Funktionsträger in seinen geschäftsführenden Vorstand aufnehmen, etwa den Schießmeister, den Jungschützenmeister, einen zweiten Schriftführer, einen zweiten Kassierer oder etwa auch Beisitzer. Nur eines sollte man hierbei beachten: Jedes Mitglied des gesetzlichen Vorstandes muss in das Vereinsregister eingetragen werden, die sonstigen Funktionsträger des Vereins oder die Mitglieder eines „erweiterten Vorstandes“ dagegen nicht. Aus je mehr Personen daher ein gesetzlicher Vorstand besteht, desto häufiger müssen auch Änderungen beim Vereinsregister angemeldet werden. Und: Soweit gesetzliche Bestimmungen den Vorstandsmitgliedern persönlich bestimmte Handlungspflichten (und damit auch Haftungsrisiken) auferlegen, treffen diese Verpflichtungen grundsätzlich alle Mitglieder des gesetzlichen Vorstandes, je mehr Mitglieder der gesetzliche Vorstand hat, desto mehr Personen unterliegen auch diesen Handlungspflichten, selbst dann, wenn dies nicht zu ihrem eigentlichen Aufgabengebiet gehört. Insgesamt also Gründe genug, die Anzahl der Mitglieder des gesetzlichen Vorstandes nicht größer zu fassen, als es für die Handlungsfähigkeit des Vereins nach außen erforderlich ist. Für die Frage, wer den Verein nach außen vertreten darf, ist aber auch aus einem zweiten Grund noch ein Blick in die Satzung erforderlich.
Die gesetzliche Regelung geht zunächst von einer Vertretung durch den gesamten Vorstand aus, hiernach müssten also alle rechtlich relevanten Erklärungen des Vereins stets von allen Vorstandsmitgliedern gemeinsam abgegeben werden. Da dies aber auf Dauer reichlich unpraktikabel wäre, bestimmen die meisten Satzungen, dass der Verein gerichtlich und außergerichtlich von z.B. zwei Vorstandsmitgliedern (oder: vom Vorsitzenden und einem weiteren Vorstandsmitglied) vertreten wird. Enthält die Satzung eine solche Bestimmung, reicht es also aus, wenn die entsprechenden Vorstandsmitglieder den Vertrag unterschreiben, um den Verein zu verpflichten. Diese Vertretungsregelung wird auch in das Vereinsregister eingetragen, ebenso werden dort die Mitglieder des Vorstands verzeichnet. Das Vereinsregister ist für jedermann einsehbar, sodass sich auch jeder, der in Kontakt zu dem Verein treten will, sich dort über die Vertretungsbefugnisse des jeweiligen Vereins informieren kann. Aber diese Vertretungsregelung greift auch in die andere Richtung: Ist etwa in der Satzung bestimmt, dass der Verein von zwei Vorstandsmitgliedern vertreten wird, ist eine Erklärung für den Verein auch nur dann bindend, wenn sie von zwei Vorstandsmitgliedern abgegeben wurde.
Besondere Vertreter
Das Vereinsrecht kennt allerdings nicht nur die Vertretung des Vereins durch den Vorstand. Denn die Satzung kann auch bestimmen, dass neben dem Vorstand für bestimmte Geschäfte besondere Vertreter bestellt werden. Die Vertretungsbefugnis eines solchen „Besonderen Vertreters“ erstreckt sich dann auf alle Rechtsgeschäfte, die der ihm zugewiesene Geschäftskreis gewöhnlich mit sich bringt. Beispiele sind etwa der Jungschützenmeister, der sich um alles zu kümmern hat, was die Jugendgruppen betrifft, und demgemäß für die Bruderschaft auch alle rechtsverbindlichen Erklärungen abgeben kann, die im Zusammenhang mit dieser Jungschützengruppe stehen. Dieser besondere Vertreter wird zwar nicht in das Vereinsregister eingetragen, soweit er sich aber innerhalb dieses ihm zugewiesenen Aufgabenbereichs bewegt, können sie den Verein also in der gleichen Art und Weise vertreten wie der Vorstand.
Sonstige Vertretungsvollmacht
Und schließlich kann der Verein auch einen Einzelnen, auch ein Nichtmitglied, damit beauftragen, für ihn bestimmte rechtsgeschäftliche Erklärungen abzugeben, wobei diese Vollmacht dann natürlich wieder durch eine genügende Anzahl von Vorstandsmitgliedern abgegeben werden muss.
Allerdings muss hierbei beachtet werden, dass eine solche Vollmacht nicht unbedingt ausdrücklich erteilt zu werden braucht, die Juristen kennen auch eine so genannte „Anscheinsvollmacht“ und eine „Duldungsvollmacht“:
Eine Anscheinsvollmacht kann sich etwa daraus ergeben, dass der Verein jemandem eine solche Position einräumt, die typischerweise mit einer bestimmten Vollmacht verbunden wird. In diesem Fall wäre der gutgläubigen Geschäftspartner, der auf das Bestehen einer Vollmacht vertraut, in diesem Vertrauen etwa auf den wirksamen Vertragsschluss geschützt, sodass hieraus der Verein verpflichtet würde, obwohl er eine „richtige“ Vollmacht gar nicht erteilt hat. Doch diese Anscheinsvollmacht ist nicht sonderlich häufig: Denn zum einen muss der Verein durch sein Handeln einen solchen Anschein setzen, zum anderen kann er ihn auch jederzeit widerrufen.
„Gefährlicher“ für den Verein ist dagegen die Duldungsvollmacht. Sie kommt dadurch zustande, dass der Verein zwar um das Handeln eines eigentlich hierfür nicht zuständigen Vereinsmitglieds weiß, gegen dieses Handeln aber nicht einschreitet. Diese Duldungsvollmacht kann auch zugunsten eines einzelnen Vorstandsmitgliedes greifen. Wurden in der Vergangenheit etwa bestimmte Verträge stets nur von dem Vorsitzenden oder nur vom Geschäftsführer unterschrieben und später dann anstandslos von dem Verein abgewickelt, können die Vertragspartner nach ein paar Jahren darauf vertrauen, dass der Vorsitzende bzw. Geschäftsführer auch berechtigt ist, diese Erklärung allein abzugeben.
Die fehlende Vertretungsmacht
Bleibt noch die Frage, was mit den Verträgen und den rechtgeschäftlichen Erklärungen geschieht, die zwar im Namen des Vereins, aber ohne eine wirksame Vertretung abgegeben wurden. Zunächst einmal ist dieser Vertrag für den Verein nicht bindend, er ist „schwebend unwirksam“.
Der Verein hat also ein Wahlrecht: Er kann den Vertrag nachträglich genehmigen, dann wird der Vertrag genauso wirksam, als wenn der Verein von vorne herein wirksam vertreten worden wäre, oder der Verein lehnt eine Genehmigung des Vertrages ab, dann treffen den Verein aus diesem Vertrag keinerlei Rechte und Pflichten, allerdings kann der Vertragspartner in diesem Fall von demjenigen, der die Erklärung für den Verein ohne die entsprechende Vollmacht abgegeben hat, Schadensersatz verlangen.
Unterschreibt also etwa der Vorsitzende allein den Vertrag mit der Musikkapelle für den nächsten Schützenball, ist der Verein hierbei regelmäßig nicht wirksam vertreten, sodass dieser Vertrag zunächst einmal für den Verein nicht bindend ist. Dies wird er erst dann, wenn der Verein – dabei wieder vertreten durch die besagten zwei Vorstandsmitglieder – den Vertrag nachträglich doch noch genehmigt, wobei diese Genehmigung nicht unbedingt ausdrücklich erfolgen muss, sondern in unserem Beispiel etwa auch darin liegen kann, dass die betreffenden Vorstandsmitglieder auf dem Ball das Spiel der Musik genießen und den Musikern freudig applaudieren.
Hat der Vorsitzende diesen Vertrag mit diesen Musikern allerdings auch in den letzten Jahren immer alleine unterschrieben und der Verein dies jeweils hingenommen, bedarf es einer solchen Genehmigung nicht mehr, in diesem Fall greifen bereits die Regelungen zur Anscheins- bzw. Duldungsvollmacht, der Verein wäre dann also auch im laufenden Jahr wirksam vom Vorsitzenden allein vertreten worden